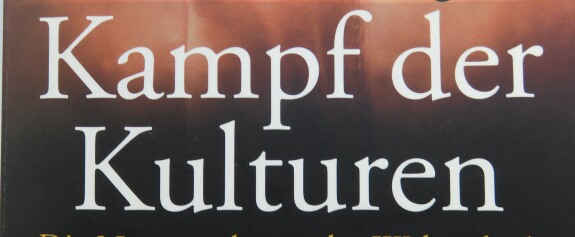
In der deutschen Taschenbuchausgabe hat der im Jahr 1996 erschienene „Kampf der Kulturen“ des Samuel P. Huntington (ohne das Register) nicht weniger als 531 Seiten. Dies ist für den Leser hartes Brot, zumal er sich durch allerlei Wiederholungen kämpfen muss. Andererseits breitet der Autor einen bemerkenswerten Reichtum an Kenntnissen aus – der ihn allerdings nicht vor Widersprüchen, falschen Gewichtungen, Fehlschlüssen und einer reaktionären Verkennung des Wesentlichen bewahrt.
Huntington, der die Welt in eine Reihe von Kulturkreisen einteilt, war entgegen Fukuyama der Auffassung, es werde keine westlich geprägte universelle Weltkultur entstehen. Vielmehr würden die aufstrebenden, eine Verwestlichung ablehnenden Kulturkreise der Sini, der Hindu und des Islam eine wachsende wirtschaftliche und damit auch politische Macht gewinnen. Dabei verweist Huntington auch auf die fortschreitende Reduzierung des westlichen Anteils an der Weltbevölkerung im Gegensatz zu dem starken Bevölkerungswachstum insbesondere in Indien und in den islamisch geprägten Ländern. Alledem könne allenfalls durch eine enge Kooperation der westlichen, im Niedergang befindlichen Staaten einigermaßen begegnet werden. Dies selbstverständlich unter Führung der USA, die, wie Huntington erstaunlich freimütig einräumt, seit langem daran interessiert sind, dass in Europa kein dominierender Staat entsteht.
Das 21. Jahrhundert werde nach allem, so Huntington, nicht von der Konkurrenz zwischen Ideologien oder von Konflikten zwischen sozialen Klassen, Armen und Reichen, sondern aufgrund fundamentaler Unterschiede in Gesellschaft und Kultur von ethnischen und kulturellen Kämpfen geprägt sein, auch und insbesondere an den Bruchlinien der Kulturkreise. Offenbar um diese Gegensätze plausibler erscheinen zu lassen, erfindet Huntington kurzerhand einen Aufschwung der christlichen Religionen im Westen und vertritt die abwegige These, die kulturelle Identität sei für den Menschen bedeutsamer als seine Interessen.
Huntington ist für „The Clash of Civilizations“ viel gescholten worden. Tatsächlich sind seine Analysen widersprüchlich und durchgehend allzu eindimensional. Sie entsprechen seinem reaktionären, von Rassismus nicht freien Weltbild und bewegen sich damit in ausweglos konfliktgeladenen Kreisen.
Erstens dienen insbesondere kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Staaten und Bevölkerungsgruppen seit jeher regelmäßig nicht primär der Behauptung von Ethnien, Religionen und oder Kulturen; diese sind häufig kaum mehr als Vorwände, mit denen das Volk auf Linie gebracht und kampfbereit gestimmt wird. Tatsächlich geht es primär schlicht um Macht, Gebietserwerb, Hegemonie, Kontrolle und vor allem um wirtschaftliche Ressourcen – und für die jeweils herrschenden Personen um Pfründe, die zusätzliche Macht bieten. Dies räumt Huntington im Detail vielfach direkt oder indirekt ein, allerdings ohne im Geringsten von seiner zentralen These abzulassen. Ungerührt klebt er auch auf Zustände und Vorgänge, insbesondere Auseinandersetzungen, die damit kaum oder nichts zu tun haben, kurzerhand das Schild „kulturell“.
Zweitens ist auch Huntingtons Analyse der islamischen Bedrohung widersprüchlich und übertrieben. Einerseits trägt er vor, der Islam sei – anders als der Westen mit den USA – dadurch geschwächt, dass die Muslime ihre säkularen Loyaliäten primär auf nichtstaatliche Einheiten wie Familie, Sippe und Stamm beschränken, ferner dank des kolonialen Westens über keinen Kernstaat, sondern über mehrere konkurrierende Machtzentren mit relativ geringer militärischer Schlagkraft verfügen, und zudem intern heillos zerstritten sind, man denke nur an die blutigen Gegensätze zwischen Sunniten und Schiiten. Überdies ist der islamistische Terrorismus, wie der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze (Geschichte der islamischen Welt von 1900 bis zur Gegenwart, 2016, C.H.Beck) offenbar bereits in der Erstauflage 1994 ausführte, Folge einer populistischen, bildungs- und wertefreien Erosion des Islam und kein Zeichen von Stärke, sondern von Schwäche. Von alledem unbeeindruckt entdeckt Huntington flugs eine machtvolle „islamische Resurgenz“ und eine gefährliche „Invasion“ von Muslimen in die europäischen Staaten, die letztere „eine christliche und eine muslimische Gemeinschaft zerfallen lassen“.
Auch bei dieser These lässt Huntington unter den Tisch fallen, was er an anderen Stellen selbst berichtet. Unterschiedliche Ethnien und Kulturen haben sehr wohl friedlich koexistiert, auch unter Beteiligung von Muslimen, und sie tun es noch. Beispiele sind das mittelalterliche Südspanien unter den Mauren, das ehemalige Jugoslawien unter Tito, noch heute der Vielvölkerstaat Indonesien und andere Staaten, ja sogar die USA mit ihren insgesamt gut integrierten – auch muslimischen – Einwanderern aus vielen Kulturkreisen. Der Mensch besteht eben nicht nur aus seiner Herkunft, Religion und Kultur, sondern als geborenes Gemeinschaftswesen nicht zuletzt aus seinen sozialen Beziehungen. Er gestaltet sein Leben selbst und passt dabei sein Denken und Tun regelmäßig an seine soziale Umwelt an, jedenfalls dann, wenn diese ihm ein menschenwürdiges Dasein bietet. Ein friedliches religiöses und kulturelles Miteinander ist umso leichter, als bekanntlich universelle Grundwerte und Verhaltensweisen existieren, die von allen großen Religionen und Kulturen gleichermaßen gebilligt und gefordert werden. Sie müssen „nur“ gelebt werden. Vertrauen entspringt entgegen Huntington eben nicht allein gemeinsamen Werten, sondern der verlässlichen Praktizierung solcher Werte.
Aber die Einsicht in die – wenn auch gegenüber dem durch Gebietsaneignung gekennzeichneten Kolonialismus früherer Jahrhunderte modifizierte – noch immer imperialistische Ausbeutung der „Dritten Welt“ durch den Westen ist Huntington eben fremd. Er bewegt sich lieber in rückwärtsgewandten Bildern kultureller Identitäten und entsprechender Abgrenzungen.
Diese Rechtslastigkeit zeigt sich auch bei der Beschäftigung mit den Ursachen dafür, dass insbesondere die Sini (vor allem Chinesen) und Moslems zwar eine Modernisierung akzeptieren, ansonsten eine universelle, westlich orientierte Kultur aber strikt ablehnen. So führt Huntington zwar aus, was für den Westen Universalismus ist, sei für den Rest der Welt Imperialismus. Die Ostasiaten verwiesen auf ihre grundsätzlich konfuzianischen Eigenschaften wie Fleiß, Ordnung, Disziplin, Enthaltsamkeit, Familienzusammenhalt und gesellschaftliches Gemeinschaftsgefühl, die nach ihrer Meinung dem hemmungslosen Individualismus des Westens überlegen seien. Für den Islam wiederum gelte der Westen als „arrogant, materialistisch, korrupt, dekadent und unmoralisch“. Der brave Amerikaner Huntington ist jedoch fern davon, die Richtigkeit dieser Sichtweisen auch nur in Teilaspekten zu bestätigen; Kritik am westlichen Vorgehen äußert er selbst nur in Bezug auf den Kolonialismus früherer Jahrhunderte. Hinsichtlich der USA spricht er nur von deren „vermeintlichen“ Fehlern. Zudem wird er nicht müde, immer wieder auf westliche Werte wie Individualismus, gesellschaftlicher Pluralismus, Gleichheit, Freiheit, freie Märkte, Demokratie, durch Gewaltenteilung kontrollierte Regierung sowie Rechtsstaatlichkeit und ein entsprechendes Sendungsbewusstsein der USA hinzuweisen.
In diesem Zusammenhang erwähnt Huntington zwar, „Nichtwestler“ bemängelten eine Diskrepanz zwischen westlichen Prinzipien und westlicher Praxis, die von Heuchelei und Doppelmoral gekennzeichnet sei. Und tatsächlich kann die chronische Zusammenarbeit des Westens mit autoritären, korrupten und mörderischen Regierungen und – von Huntington nicht einmal im Ansatz genannt – die gnadenlose Bekämpfung von Sozialreformern wie Mossadegh im Iran und Allende in Chile durch die CIA ja auch kaum anders bezeichnet werden. Dabei verschweigt Huntington, dass diese Abgründe seit jeher gleichermaßen von zahlreichen „Westlern“ (wie Noam Chomsky) kritisiert werden, und nicht zuletzt die noch immer primär der Gewinnung oder Erhaltung von wirtschaftlichen Ressourcen sichernden Praktiken insbesondere der USA die Übernahme einer westlich geprägten, universellen Kultur für andere Kulturkreise inakzeptabel machen. Mehr noch: Der ehemalige Regierungsberater der USA versteigt sich sogar zu der bodenlos zynischen Aussage: „Doppelmoral in der Praxis ist der unvermeidliche Preis für universalistische Prinzipien.“
Auch bleibt im „Kampf der Kulturen“ zwar nicht unerwähnt, dass die westliche Kultur für den Moslem „verführerisch“ sein kann, ebenso wenig, dass sich „riesige Scharen arbeitsloser und entfremdeter junger“ Moslems „für die islamistische Sache einspannen lassen“. Aber als Ursache für letzteres benennt Huntington lediglich „das muslimische Bevölkerungswachstum“. Die Darstellung bei Reinhard Schulze ist wesentlich komplexer und einleuchtender. Danach war das 20. Jahrhundert durch einen Diskurs nahezu aller Strömungen und Institutionen des Islam über dessen Einbindung in moderne, westliche Konzepte gekennzeichnet. Dazu gehörte auch eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und Bemühungen um eine zeitgemäße, modernisierende Reform. Die dabei entwickelten Visionen eines gesellschaftlichen und regelmäßig staatssozialistischen Primats, bei dem Bildung noch eine Ressource für ein gelingendes Leben darstellte, setzte sich jedoch nicht durch. Die so entstehende Lücke wurde durch den tatsächlich „verführerischen“ Markt gefüllt, allerdings bei weithin unerfüllten Konsumerwartungen der verarmten Massen. Die daraus resultierende soziale Unzufriedenheit der Vielen, die angesichts der wirtschaftlichen Globalisierung nicht einmal eine planbare Zukunft für sich sahen und sehen, bereitete den Boden für eine populistische, bildungsferne Reduzierung des Islam auf ein schlichtes bloßes Normengefüge des „richtig oder falsch“ unter Ausblendung moralischer Kategorien, und damit den islamistischen Terror, der durch wirre Jenseitserwartungen schmackhaft gemacht wurde. Diese Entwicklung wurde dadurch befördert, dass die bürgerlichen Medien auch des Islam (die islamische „Lügenpresse“) die Kontrolle über den öffentlichen Diskurs verloren.
Hier zeigt sich ein konvergenter Niedergang grundlegender Ordnungsvorstellungen in der islamischen wie der westlichen Welt. Die Ursachen liegen weitgehend in der – für das Musterland des Kapitalismus USA kennzeichnenden – machtvollen monetären Gier der globalisierten Wirtschaft, die weltweit, in allen Kulturkreisen, sinnlos Riesenvermögen in den Händen jeweils einiger weniger Personen produziert, die Massen der Weltbevölkerung hingegen perspektivloser Armut aussetzt. Diese unsolidarische, von der Politik des Westens seit Jahrzehnten geförderte Trittbrettfahrermentalität der Wenigen weist seit langem den Weg zur Gewalt, ob es sich um islamischen Bombenterror oder Aufstände in Lateinamerika handelt. Und setzt man deutsche Ängste mit realer Armut gleich, gehören auch brennende Asylantenheime dazu. Huntington erwähnt in anderem Zusammenhang kaum mehr als nichtssagend eine soziale Desintegration in den USA. Der Kern des Problems ist eben ein anderer: Die Menschen kooperieren nicht genügend, und der ungezügelte westliche Individualismus verstärkt diese Fehlentwicklung.
Nun mag man dem ehemaligen Regierungsberater der USA manches verzeihen, obwohl Harvard seit langem einen guten Ruf genießt. Nicht hinnehmbar ist dagegen Huntingtons Rassismus, der auf S. 329 offen zu Tage tritt. Dort zeigt er unter den Überschriften „Die USA im Jahre 2020: ein gespaltenes Land?“ und „Geschätzter prozentualer Anteil von Schwarzen, Asiaten, Indianern bzw. Hispanics an der Bevölkerung (nach County)“ eine in „unter 10% , 10 bis 25 %, 25 bis 50% und 50% und mehr“ eingeteilte Karte, die auch für den deutschen AfD-Anhänger oder „Identitären“ ein Schreckensbild sein muss. Dass Huntington dabei die „Schwarzen“ noch immer als Spalter der USA bezeichnet, obwohl sie seit Jahrhunderten integraler Bestandteil des amerikanischen Volkes sind und die USA ihnen unendlich viel verdanken, unter anderem lang anhaltende Sklavenarbeit, beherzte Einsätze im Zweiten Weltkrieg und in nachfolgenden Kriegen für die USA, auch die herausragende Kulturleistung des Jazz, ist nicht weniger als skandalös.
Es erstaunt denn auch nicht, dass Huntington wenige Jahre nach dem „Kampf der Kulturen“ unter dem Titel „Who Are We. The Challenges to America´s Identity“ ein Pamphlet veröffentlichte, in dem er sich gegen die lateinamerikanische, insbesondere mexikanische Einwanderung in die USA aussprach, eine Rückwendung zu den anglo-protestantischen Werten der ersten europäischen Siedler befürwortete und als mögliches Szenarium der Zukunft eine bi-kulturelle, zweisprachige Gesellschaft in den USA an die Wand malte, wobei Latinos in einigen Staaten der USA dominieren und Angloamerikaner in andere Staaten ausweichen. Hinzu kommt, dass Huntington nicht nur den Vietnamkrieg, sondern auch die amerikanische Unterstützung der damaligen Militärdiktatur in Brasilien verteidigte und Südafrika unter der Apartheid als „zufriedene Gesellschaft“ bezeichnete….
Amartya Sen hat zum „Kampf der Kulturen“ unter anderem bemerkt, dass Rechtspopulisten wie Samuel P. Huntington Grundsteine für eine Ideologie der Gewalt legen. Tatsächlich: Dieses Buch ist unverantwortlich.
